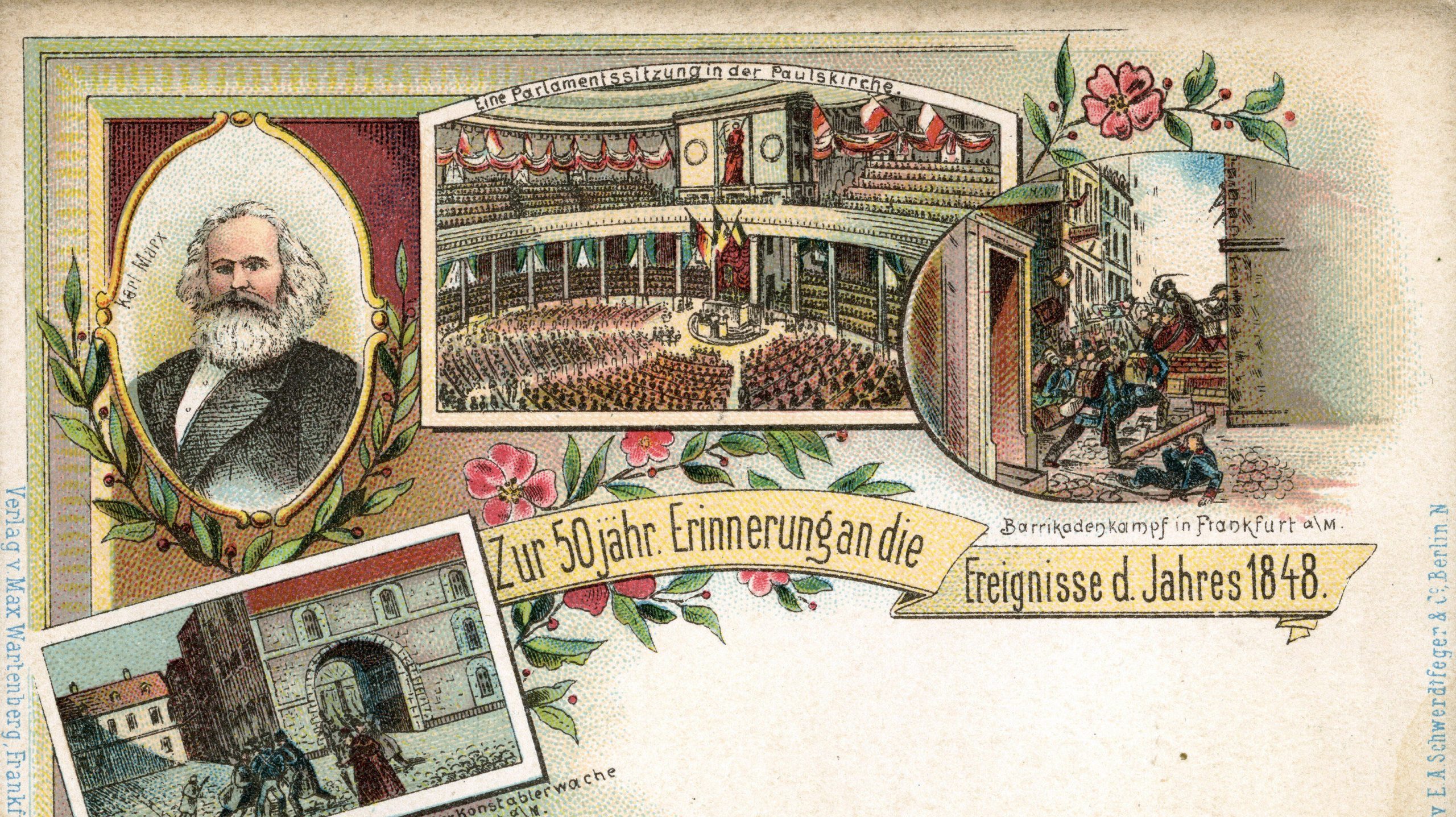Foto Aaron Sahr
Aaron Sahr: „Das Geldsystem muss nicht das Problem sein, es könnte auch die Lösung sein.“
Geld gehört auf selbstverständliche Weise zu unserer Lebenswelt dazu, doch woher kommt unser Geld eigentlich und wie diskutieren wir darüber? Muss Geld immer eine knappe Ressource sein? Diese und andere Fragen hat unser Herausgeber Otmar Tibes mit dem Hamburger Wirtschaftssoziologen und Autoren Aaron Sahr besprochen.
Herr Sahr, seit Ausbruch der Pandemie haben Regierungen und Zentralbanken gigantische Geldsummen ausgegeben, um die Pandemie und ihre ökonomischen Folgen zu bekämpfen. In der Öffentlichkeit hat das zu hitzigen Debatten über die richtige Geldpolitik geführt. Wollen Sie mit Ihrem neuen Buch, das den Untertitel „Kritik der finanziellen Vernunft“ trägt, nun eine kritische Sichtweise auf diese Diskurse einnehmen?
Was mich nachhaltig fasziniert ist die Spannung zwischen einem öffentlichen Diskurs über Geld und Geldpolitik, in dem es beispielsweise häufig um die Sparsamkeit des Staates und die Vermeidung von Staatsschulden geht, und einem akademischen Diskurs, in dem zumeist unter völlig anderen Prämissen argumentiert wird. Beide Diskurse sehen füreinander völlig verrückt aus: Zum Beispiel gehen viele von uns im Alltag davon aus, dass Geld in einer bestimmten Menge vorhanden ist und der Staat nur das Geld ausgeben kann, was er vorher eingenommen hat. Schulden werden meist auch als etwas Schlechtes empfunden, weshalb es immer besser ist, wenn der Staat keine zusätzlichen Schulden aufnimmt und so weiter. Auf der akademischen Seite wird wiederum gesagt, dass Schulden das sind, aus dem die Wirtschaft und das Geld selbst besteht und dass das Geld von der öffentlichen Hand bereitgestellt wird. Oder dass Geld letztendlich immer verfügbar ist, wenn man es braucht. Weil diese beiden Argumentationszusammenhänge füreinander völlig unvernünftig und verrückt aussehen, muss man zunächst einmal zurückfragen und klären, was eigentlich die Prämissen und Vorannahmen sind, unter welchen diese Diskurse geführt werden? Darauf spielt auch der Untertitel meines Buches an: Ich frage, warum der traditionelle öffentliche Diskurs bestimmte Sachen als vernünftig empfindet, die andere als völlig unvernünftig sehen – und andersherum.

Aaron Sahr
Es ist interessant, dass diese beiden Diskurse so auseinanderlaufen. Könnten die Erfahrungen aus der Pandemie vielleicht helfen, sie einander wieder anzunähern? Vielleicht ließe sich anhand des tatsächlichen Handelns von den Zentralbanken ja entscheiden, welcher Diskurs vernünftiger ist.
In der Pandemie konnte man sehen, dass die Art und Weise, wie mit unserem Geldsystem umgegangen wird — also wie zum Beispiel die Zentralbanken handeln —, mit einem Alltagsdiskurs über Schulden, Staatsausgaben und Steuern kaum mehr in Einklang zu bringen ist. Die EZB hat zum Beispiel Milliarden von EURO geschaffen, einfach weil bestimmte Kennziffern nicht mehr eingehalten werden konnten. In dieser Situation war Geld nicht knapp, sondern in fast beliebiger Menge verfügbar, da es einen akuten Bedarf gab und man von einer bestimmten Zielmarke abzuweichen drohte. Es musste auch nicht zunächst erwirtschaftet oder angespart werden. Das löst Irritationen aus, weil diese Vorgänge und Entscheidungen nicht so Recht zusammenpassen wollen mit den Alltagsvorstellungen von Geld, Staatsfinanzierung und Schulden und dergleichen.
Wie sollte man mit dieser problematischen Diskurslage umgehen?
Anstatt sich gegenseitig für verrückt zu erklären, sollte man die Spannung ernst nehmen und sich fragen, warum im öffentlichen Diskurs so anders über Geld, Staatsfinanzen und Schulden geredet wird, als in Teilen des akademischen Diskurses? Auch sollte man sich fragen, was es eigentlich bedeutet, dass es noch eine völlig andere Beschreibung des Geldsystems gibt, von der viele Fachleute sagen — auch wenn sie in Detailfragen nicht immer einig sind —, dass sie das Geldsystem viel besser beschreibt.
Wie würden Sie unser Geldsystem im Kontrast zu unserem Geldverständnis beschreiben?
Wir haben in der Regel eine relativ abstrakte Vorstellung davon, was Geld ist, nämlich ein großer Vorrat an wertvollem Eigentum. Wir meinen damit, dass jeder seinen eigenen Haufen an monetären Wert hat. Genauso wie man sein eigenes Auto oder seine eigene Wohnung besitzt, besitzt auch jeder sein eigenes Bankguthaben bzw. Geld im Portemonnaie. Der Nachbar, die Chefin usw. Alle haben einen eigenen Geldvorrat, so wie alle ihre eigenen Besitztümer haben. Im Kontrast dazu gibt es aber eine Beschreibung des Geldsystems, die an der rechtlichen Verfassung desselben ansetzt. Sie setzt bei der Grundsatzfrage an, was man eigentlich genau „hat“, wenn man Guthaben auf dem Konto hat? Was man tatsächlich hat, ist ein Vertrag mit einer Bank, der eine Schuld darstellt. Dieser Vertrag wird nämlich als eine Schuld gegenüber der Kundin oder dem Kunden von der Bank bilanziert. Die Bank schuldet ihrem Vertragspartner eine bestimmte Summe und diese Summe nennen wir Geld. Aber was ist dieses Geld eigentlich, wenn wir weiter in dieser rechtlichen Beschreibung bleiben? Die Summe auf dem Konto ist ein Versprechen der Bank, dass man Überweisungen tätigen und Bargeld abheben kann. Wenn man Überweisungen tätigt, dann heißt das, dass die eigene Privatbank mit ihrem Konto bei der Zentralbank einen Transfer zu der Privatbank des Empfängers vornimmt. Und wenn man jetzt fragt, was dieses Konto bei der Zentralbank ist, dann steht dieses Konto wiederum für einen Vertrag, der zwischen der Zentralbank und privaten Bank besteht. Mit anderen Worten wieder eine Schuld, die von der Zentralbank als Verbindlichkeit bilanziert wird. Und dort finden wir auch das Bargeld, das ebenfalls als Schuld der Zentralbank bilanziert wird. Wer also ein Guthaben auf seinem Bankkonto hat, der besitzt die Schuld einer Bank, die man zum Bezahlen einsetzen kann, weil es noch weitere Schulden gibt, nämlich die zwischen Privat- und Zentralbank.
Unsere Bankguthaben sind also vertragliche Schuldverhältnisse?
Ist man zum ersten Mal mit dieser Beschreibung konfrontiert, dann fragt man sich, worauf das alles hinauslaufen soll? Das klingt doch irgendwie konfus: eine Schuld, die auf eine Schuld verweist!? Tatsächlich ist das aber die Konstruktionsweise unseres Geldsystems: Schulden, die auf Schulden verweisen, und die wir benutzen können, um andere Schulden zu tilgen. Zum Beispiel um Rechnungen zu bezahlen oder Mietschulden zu begleichen. Schulden sind also das Prinzip, auf dem wir unsere Geldordnung errichtet haben. Das führt uns von der allgemeinen Vorstellung des Geldes als kleinen Haufen wertvollen Eigentums im Portemonnaie oder auf dem Bankkonto weg und bringt uns zu einer großen Struktur, nämlich einem Geflecht von Schulden, das uns ermöglicht, Zahlungen vorzunehmen. Einfach, indem Banken und Zentralbanken miteinander kooperieren und Schulden ein- und austragen.
Die semantische Verschiebung, die man bei dem Begriff »Schulden« beobachten kann, ist wirklich bemerkenswert. In dieser Beschreibung unseres Geldsystems ist die Schulderschaffung nichts Geringeres als das Prinzip der Geldschöpfung.
Die Bedeutung von Schulden wird in dieser Beschreibung durchaus verschoben. Im Augenblick, wo wir nämlich feststellen, dass unser Geldsystem kein Haufen einzelner Geldbeträge ist, sondern ein Geflecht aus Schulden, können wir Schulden nicht mehr nur im problematischen Sinne verstehen, sondern müssen sie zwangsläufig auch in einem positiven Sinne begreifen. Schulden sind das, woraus unser Geld und folglich auch unser Geldsystem besteht. Sie sind die Bausteine des Geldes. Und wenn man jetzt danach fragt, wie es gelingen kann, dieses System aufrechtzuerhalten und was man tun muss, damit es überhaupt operieren kann, dann kommen wir ganz schnell in eine völlig andere Erzählung über Geld und die Rolle des Staates oder die Frage der Finanzierbarkeit und der Geldschöpfung, als wir zunächst im Alltagsdiskurs sind.

Ein Problem ist sicherlich, dass den meisten Menschen völlig unklar ist, wie im Hintergrund das Geldsystem tatsächlich funktioniert. Für den öffentlichen Diskurs ist das umso problematischer, weil er dann zu viele Missverständnisse als Prämissen hat. Würden Sie der Aussage zustimmen, dass das insbesondere die Rolle von Schulden betrifft?
Missverständnisse über die Bedeutung und Rolle von Schulden sind in der Tat das Kernproblem geldpolitischer Debatten. Das liegt letztendlich daran, dass wir über Schulden immer aus der individuellen oder betriebswirtschaftlichen Perspektive nachdenken. In dieser Perspektive werden Schulden gemeinhin als ein Ersatz für das Sparen oder andere positiv besetzte Dinge verstanden. Tugenden wie Geduld, Fleiß und Einsatzbereitschaft zum Beispiel. Wer sich verschuldet, so heißt es dann, will Leistungen sofort, bevor man sie sich erarbeitet hat. Wenn das immer die Erstassoziation ist, die wir mit Schulden verbinden, dann sind Schulden natürlich negativ konnotiert. Sie müssen die Ausnahme bleiben und dürfen nicht zur Regel werden. Und wenn ein politischer Diskurs auf dieser Prämisse gründet, dann kollidiert das an allen Ecken mit einer Betrachtung des Systems aus einer Makroperspektive. Aus dieser Perspektive ist es nämlich sinnvoll schon alltägliche Aktionen und Interaktionen als Verschuldungszusammenhang zu begreifen. Selbst wenn man eine Ware an der Supermarktkasse mitnimmt, schließt man einen Kaufvertrag ab, der eine Zahlungsverpflichtung darstellt, die dann sofort beglichen wird. Mit Bankschulden. Aber auch abseits dessen ist man in Zahlungsverpflichtungen eingeflochten. Man muss nur an den eigenen Vermieter oder Streamingdienst denken, dem man jeden Monat Geld schuldet. Diese Personen schulden einem zwar auch etwas, der zentrale Punkt ist jedoch, dass wir in dieser Beschreibung alle schon in Zahlungsverpflichtungen eingeflochten sind und Zahlungsverpflichtungen auch das sind, womit und wodurch wir im Alltag ökonomisch agieren können.
Und wenn wir jetzt danach fragen, warum es Geld überhaupt gibt, was würden Sie darauf antworten?
Geld gibt es deshalb, weil sich die ganze Zeit Leute bei Banken verschulden, um neue Guthaben in das System einzustellen. Wenn sich nicht die ganze Zeit Leute bei Banken verschulden würden — sowohl private als auch öffentliche Akteure — dann würde das ganze Geld aus dem System raus fließen, weil es bei der Rückzahlung von alten Krediten wieder verschwindet. Wir sind also gesamtwirtschaftlich darauf angewiesen, dass sich die ganze Zeit Leute verschulden. Man könnte die Bedeutung von Schulden auch so zusammenfassen: Im Alltag sind wir alle ständig in Zahlungsverpflichtungen eingeflochten. Schon hier sind Schulden also ein ganz normales Bauteil unserer Ökonomie. Dann brauchen wir Verschuldung, um unser Geld bereitzustellen. Auch hier sind Schulden also etwas grundsätzlich Positives und Wichtiges. Und dann besteht Geld auch noch aus nichts anderem als Bankschulden. Die ganze Matrix der Ökonomie besteht eigentlich aus Zahlungsverpflichtungen. Und das kollidiert mit einem öffentlichen Diskurs, der aus einer eingeschränkten betriebswirtschaftlichen und individualistischen Perspektive auf Schulden blickt und sie dabei immer als problematisch markiert… Wir müssen deshalb gucken, dass wir zu einer positiv besetzten Erzählung von Schulden kommen, um einen vernünftigen Diskurs über unser Geldsystem hinzukriegen. Das bedeutet nicht, dass alle Schulden per se gut sind oder dass man immer so viele Schulden machen kann, wie man will. Es heißt vielmehr, dass wir immer auf die falsche Fährte gelangen, wenn wir mit einem negativen Schuldenbegriff — also nicht mal einen neutralen, sondern einen wirklich immer negativ besetzten Schuldenbegriff — anfangen uns darüber zu verständigen, wie wir unser Gemeinwesen und unsere Wirtschaft organisieren wollen. Das findet nämlich dann alles unter Prämissen statt, die mit der Realität des Systems kollidieren.
Diese Prämissen — manche würden sogar von Dogmen sprechen, weil andere sie ganz dogmatisch verteidigen, wenn sie kritisch hinterfragt werden — stehen einem vernünftigen Diskurs über das Gemeinwesen und der Wirtschaft im Wege. Man müsste deshalb versuchen den Menschen beizubringen, etwas differenzierter mit dem Schuldenbegriff umzugehen. Doch müssten sie nicht auch ebenso reflektieren, dass sie ihre falschen Vorstellungen von unserem Geldsystem auf den Staat projizieren — obwohl der Staat nicht wie ein Privathaushalt oder Unternehmen funktioniert?
Dass wir versuchen unser Gemeinwesen in Analogie zu einem Privathaushalt zu organisieren, gehört auf jeden Fall zum Kernproblem dazu. Denn letztendlich verlangen wir damit auch, dass sich der Staat so verhält, wie wir uns privat verhalten. Das ist auch immer wieder an der problematischen Metaphorik der „schwäbischen Hausfrau“ erkennbar, mit der wir auf den Staat Bezug nehmen. Die Vorstellung vom Staat als große Form eines Privathaushalts ist allerdings falsch. Unglücklicherweise steckt sie aber tief in unseren Erzählungen drin. Wir finden sie deshalb auch in den Geschichtsbüchern. Zum Beispiel in dem berühmten Diktum von Margaret Thatcher: „Es gibt kein anderes Geld, als das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler“. Daraus wird dann die Erzählung vom parasitären Staat gemacht, der nur vom Geld seiner Bürgerinnen und Bürger lebt. Was man mit diesen Erzählungen aber nicht beantworten kann, ist die Frage, wo das Geld der Bürgerinnen und Bürger eigentlich herkommt? Die Erzählung hat nämlich keine Geldtheorie. In einem vernünftigen und sinnvollen Diskurs müsste man also thematisieren, wie Geld entsteht und wo es eigentlich herkommt. Dafür müssen wir aber auch über den Staat hinausblicken und einen makroskopischen oder systemischen Blick auf die Ökonomie einnehmen. Das meint einen Blick, der sich nicht der Dominanz eines ökonomischen Dogmas verschreibt, nach welchem die Wirtschaft aus individuellen Haushalten zusammengesetzt ist. Nach diesem Dogma wird nämlich immer nur hochgerechnet, wie sich einzelne Haushalte in der Masse verhalten, um ein Gesamtbild zu erhalten. Man kann die Wirtschaft insgesamt aber nicht verstehen, wenn man von der individuellen Perspektive hochrechnet. Wenn man hingegen von der Gesamtwirtschaft ausgeht, sieht man, dass der Staat in seiner Funktion eine ganz andere Rolle spielt und historisch auch de facto gespielt hat, als private Haushalte das tun. Nicht zuletzt, weil die Schulden vom Staat das Vermögen der Zentralbanken ausmachen und diese auch die Grundlage der Geldversorgung sind. Auch wenn es vielleicht nach trockener Buchhaltung klingt, sollte man sich unbedingt einmal klar machen, dass Zentralbanken selbst Vermögen und Schulden haben, und die staatlichen Schulden bei den Zentralbanken als Grundlage unserer Geldversorgung dienen. Das Vermögen der Zentralbanken besteht nämlich größtenteils aus Staatsschulden.
Was bedeutet es dann konkret, wenn der Staat sich verschuldet?
Das bedeutet, dass der Staat sich Zentralbankgeld leiht, also in ein Schuldverhältnis mit einer seiner eigenen Institutionen eintritt. Bei der Zentralbank hat der Staat nämlich sein Konto. Die Zentralbank nimmt die Staatsschulden dann wiederum als Vermögen in ihre Bilanzen auf. Es gibt dieses Geld also nur, weil die Zentralbank die Schulden eines Staates als Vermögen führt. Man sollte das aber nicht skandalisieren, sondern als Beschreibung erstmal bloß würdigen. Wenn man es allerdings zur Kenntnis genommen hat, dann macht es plötzlich kaum noch Sinn über Staatverschuldung und Staatsausgaben zu sprechen, als wäre der Staat ein Privathaushalt. Einfach weil die Schulden von Privathaushalten nicht die Grundlage unserer Geldversorgung sind. Das heißt aber auch nicht, dass der Staat so viele Schulden machen kann, wie er will. Das ist oft ein Gegenargument, das sofort kommt: „Wenn der Staat machen kann, was er will, dann passiert doch das und das“ usw. Darum geht es aber erstmal gar nicht. Vielmehr geht es darum, dass wir öffentliche Debatten unter Prämissen führen, die diese Abläufe gar nicht zur Kenntnis nehmen. Wenn man einmal von einem kleinen Fachkreis absieht. Das führt jedoch dazu, dass in unserer Demokratie Forderungen und Erwartungen an den Staat herangetragen werden, die vollkommen kurios und realitätsfern sind.

Wir sind also in Debatten gefangen, in welchen ganz grundlegende Abläufe unseres Geldsystems nicht bekannt sind. Dagegen hilft eigentlich nur Aufklärung. Zugleich müssen wir aber auch politisieren, denn für bestimmte Probleme wäre es erforderlich, dass wir unser Geldsystem anders einsetzen. Da können wir uns nicht jahrelang mit falschen Problemen aufhalten. In welche Richtung würden sie eine Politisierung für sinnvoll erachten? Wäre zum Beispiel eine Erweiterung der Mandatierung von Zentralbanken ein Ansatzpunkt?
Ein Ansatzpunkt wäre die Überwindung des vorherrschenden Dogmas, das bloß eine technische Verwaltung des Geldes als legitimen geldpolitischen Anspruch zulässt. Darauf beruht nämlich die Mandatierung einer unabhängigen Zentralbank mit der Leitaufgabe der Preisstabilität. Alle anderen Aspekte — vor allem die Aspekte der Geldschöpfung — werden diesem Ziel dann untergeordnet. Die EZB darf ihre eigenen Geldschöpfungsfähigkeiten etwa nur in Hinblick auf die Preisstabilität einsetzen. Heute findet zwar eine juristische Debatte darüber statt, ob Zentralbanken diese Aufgabe mit ihren Ankaufprogrammen, dem Quantitative Easing noch erfüllen oder vielleicht sogar ihr Mandat verletzten. Aber gerade dadurch zeigt sich, dass wir von der Zentralbank erwarten, alle ihre Entscheidungen im Hinblick auf ein einziges Ziel – Preisstabilität – zu rechtfertigen. Die EZB begründet ihre Maßnahmen deshalb mit Sätzen wie: „Wir müssen Deflation verhindern, deswegen machen wir das“. Auf der einen Seite hat man das Mandat der Zentralbanken also auf ein sehr enges Verständnis davon eingeschränkt, was gute Geldpolitik ist, und auf der anderen Seite hat man gesagt, dass private Banken tun und lassen können, was sie wollen — so lange eben die Preise stabil sind. Ab den 1980er hat man dann angefangen übliche Kontrollen der privaten Geldschöpfung — die sog. Kreditkontrollen — abzubauen. Vorher waren private Banken bei der Kreditvergabe deutlich eingeschränkter, man könnte auch sagen: private Geldschöpfung war ein Politikum. Die private Geldschöpfung — also die Kreditvergabe privater Banken — wurde für bestimmte Sektoren gefördert, für andere, etwa Immobilien, erschwert. Mit der Deregulierung der Banken wurde dieses Regime dann als „dunkles Zeitalter“ verklärt. Viele sprechen deshalb bis heute von einer Phase „finanzieller Repression“. In der Forschung hat man aber inzwischen angefangen, dieses Zeitalter neu zu evaluieren. Verschiedene Leute wie Dirk Bezemer oder Josh Ryan-Collins machen das und sagen uns, dass wir nochmal genau hingucken und bewerten müssen, was davon wirklich schlecht oder eigentlich ganz gut war…
Wir haben bei der Frage der Politisierung des Geldsystems also zwei Felder: die Frage der Veränderung des Zentralbankmandats und die Frage der Steuerungsansprüche an die private Geldschöpfung. Welche Aufgaben muss eine Zentralbank heute übernehmen und welche Steuerungsansprüche sollte eine demokratische Gesellschaft an private Geldschöpfung stellen – darum geht es. Wir müssen etwa darüber reden, ob man private Geldschöpfung für den den Handel mit Immobilien in Großstädten vielleicht besser begrenzt, weil eine Mietpreisbremse allein nicht funktionieren kann, wenn weiterhin immer mehr neu geschaffenes Geld in den Immobilienmarkt fließt. Oder man könnte fragen, ob man Refinanzierungsgeschäfte für Nachhaltigkeitsprojekte grundsätzlich günstiger anbieten muss, weil wir eine grüne Transformation wollen. Derartige Kreditkontrollen müssen in den politischen Diskurs zurückkommen, ohne dass sie gleich mit reflexartigen Diskurssperren belegt werden. Also mit der Keule der Unvernunft totgeschlagen oder mit dem Vorwurf des ewig gestrigen Sozialismus gebrandmarkt werden. Da muss man wirklich einmal evaluieren, was man da machen kann und was eigentlich funktioniert. Die andere Baustelle der Politisierung ist wie gesagt das Zentralbankmandat. Da muss man in Europa klären, inwiefern das enge Mandat der EZB heute noch funktioniert und ob es jemals funktioniert hat? In Europa darf die Zentralbank nämlich nur privaten Akteuren Schuldpapiere abkaufen, vorausgesetzt natürlich, dass dies in Hinblick auf die Preisstabilität geschieht. Tatsächlich wird darüber jetzt eine kleine Debatte geführt. Wenn ich aber aus der eigenen Blase hinausgucke, muss ich feststellen, dass es noch eine sehr kleine Debatte ist. Sie muss also weitergeführt werden. Wichtig ist, dass wir einsehen, dass es für eine demokratische Gesellschaft völlig legitim ist, über die Organisation ihres Geldsystems jenseits der vermeintlichen Ideale unabhängiger Zentralbanken und Preisstabilität hinaus zu beratschlagen. Vielleicht muss es neben der Preisstabilität noch andere Kriterien geben, an denen die Zentralbanken ihr Handeln ausrichten und durch die sie ihre Entscheidungen legitimieren können – etwa Nachhaltigkeit? Oder könnte die EZB nicht auch dafür zuständig sein, die Zahlungsfähigkeit einzelner Mitgliedsstaaten in der Eurozone sicherzustellen, weil sie am Ende ja unser aller Bank ist – und nicht nur die Bank der Kapitalmärkte. Ich will mit diesen Beispielen gar nichts vorgeben. Worauf ich lediglich hinweisen möchte, ist, dass wir die Debatten schrittweise dafür öffnen müssen, damit nicht jeglicher Anspruch der Gesellschaft an das Geldsystem als eine Störung desselben empfunden wird. Vieles, was zum Mandat der EZB gesagt wird, wird nämlich gleich mit „Hyperinflation“ und „Weimarer Verhältnissen“ gekontert. Das ist leider eine völlig irrationale Debattensituation, aus der man rauskommen muss, um die beiden Felder der Politisierung breiter und systematischer diskutieren zu können. Also die Politisierung des Zentralbankmandats und die Politisierung des privaten Bankensektors im Sinne von Steuerungsansprüchen an die private Geldschöpfung.
Wenn man von dem privaten Finanzsektor ausgeht, der nur deshalb wächst, weil mit privaten Vermögenswerten spekuliert wird, und dann darauf hinweist, dass dieses Wachstum inzestuös ist, einfach weil nur der Finanzsektor von diesem Wachstum profitiert, die Realwirtschaft aber immer leer ausgeht, dann könnte eine Historisierung hilfreich sein. Einfach, weil man im Westen auf ein Zeitalter verweisen kann, in welchem die Wirtschaft ungeheuer stark wuchs und der Banksektor gleichzeitig strengreguliert war. Ich meine damit die Phase der Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre. In den Geschichtsbüchern gilt diese Ära als das goldene Zeitalter des Kapitalismus. Man kann aus dieser historischen Phase lernen, dass sich Wachstum und Regulierung nicht ausschließen müssen. Doch leider sind die Wirtschaftswissenschaften heute eine nahezu ahistorische Disziplin. Nach der neoliberalen Wende ist ungeheuer viel Wissen über die Wirtschaftsgeschichte verloren gegangen.
Das Fatale an dem Bruch seit den 1980er Jahren ist nicht nur, dass sich die Vorstellung durchgesetzt hat, die Wirtschaft müsse dereguliert werden und die Finanzmärkte gefördert, weil sie die neuen Wachstumsquellen sind, sondern eben auch, dass all dies als Fortschritt markiert wurde. Man sprach von den „Nachwirkungen des letzten Jahrhunderts“ und einem Staat, der sich „vollkommen überschätzt“ habe. Gottseidank hat man „das alte System“ und „die Vergangenheit“ überwunden, hieß es dann. In der Forschung wird bis heute ganz selbstverständlich – wir haben schon darüber geredet – von „finanzieller Repression“ gesprochen, womit gemeint wird, dass die verrückten Leute von früher ihr Finanzsystem klein gehalten haben, obwohl es auch ganz groß hätte werden können. Festgehalten wird auf diese Weise, dass die Leute in ihrem dunklen Zeitalter leider nicht verstanden haben, wie es geht. — Das ist allerdings keine neutrale Beschreibung der Vergangenheit und auch der Begriff „finanzieller Repression“ ist kein neutraler Begriff… Ich will damit nicht behaupten, dass jede Deregulierungsmaßnahme seit den 1980er Jahren unsinnig gewesen ist. Es gab damals auch Schwierigkeiten bei der Kreditversorgung, zum Beispiel bei der Versorgung des Mittelstandes. Allerdings hat sich eine Erzählung von der Vergangenheit durchgesetzt, die staatliche Steuerungsansprüche an das Finanzsystem völlig diskreditiert haben. Das kann man auch ganz konkret an Begriffen wie der „monetären Staatsfinanzierung“ sehen, der regelrecht tabuisiert wurde, obwohl das in manchen Ländern wie Kanada sehr erfolgreich und mit sehr viel Bedacht eingesetzt wurde. Die pauschale Warnung, man dürfe die Politiker niemals wieder an das Finanz- und Geldsystem lassen, obwohl Demokratien in der Vergangenheit gar nicht so schlecht darin waren, sich selbst zu bescheiden und das Geldsystem nur für bestimmte Zwecke eingesetzt und reglementiert haben, ist also ziemlich abstrus. Es gab ganze Phasen, in welchen Kreditkontrollen und politische Zugriffe auf Zentralbanken gut funktioniert haben. Deshalb ist es so ärgerlich, wenn die Vergangenheit als „dunkles Zeitalter“ gebrandmarkt wird und all jene, die davon sprechen, aus dem Kreis der vernünftigen Diskutanten ausgeschlossen werden. Das ist auch ein entscheidender Grund dafür, dass es jahrelang kaum Forschung zu diesen Phasen gab. Erst jetzt beginnen Fachleute zurückzuschauen und mehr Publikationen zu Kreditkontrollen vergangener Phasen zu schreiben. Und viele, die das dann lesen, reagieren total überrascht und interessiert daran, was es für Steuerungsansprüche an das Geldsystem gab. An diesem Framing der Vergangenheit als „dunkles Zeitalter“ merkt man also, wie tiefgehend das Problem eigentlich ist.
Es zeigt, wie tiefgehend das Problem ist und wie viele Bereiche das Problem tangiert. Denn es mangelt nicht nur in der Öffentlichkeit an wichtigem Wissen, sondern auch in den Wirtschaftswissenschaften selbst. Sogar akademisch ausgebildete Ökonom:innen sind heute nicht mehr mit der Wirtschaftsgeschichte vertraut. Wie soll auf dieser Grundlage dann eine sachliche Debatte in der Öffentlichkeit geführt werden? Es mangelt schon an fachlichen Grundlagen dafür…
Eine Ursache des Problems ist sicherlich auch das dominierende Selbstverständnis der ökonomischen Wissenschaft als ahistorischer Wissenschaft. Und auf dieser Basis finden auch die Politikberatung statt. Ihr liegen Modelle zugrunde, die auf Gesetzmäßigkeiten beruhen, die sich entdecken lassen. Damit will ich gar nicht in Abrede stellen, dass man mit diesen Modellen auch wichtige Einsichten gewinnen kann. Ich will lediglich darauf hinweisen, dass sie auf einer Vorstellung von Wirtschaft beruhen, die im Prinzip ahistorisch ist, und die deswegen immer auch als eine Überwindung vergangener Zeiten und Zustände erzählt werden kann. Es heißt dann schnell, dass früher alles schlechter war und heute alles viel besser funktioniert, weil es früher an Wissen über ökonomische Gesetzmäßigkeiten fehlte oder einfach ignoriert wurden Darüber hat auch Joseph Vogl geschrieben. Zum Beispiel hat er kritisch bemerkt, dass die Deregulierung der Finanzmärkte in den 1980er und 1990er Jahren als Entstehung einer Art ökonomischen Himmelreichs gefeiert wurde. Freie Finanzmärkte galten dann als das, was Ökonomen mit ihren Modellen immer schon beschreiben wollten, einfach weil es so schien, als könnten sich hier erstmals Information frei bewegen und deswegen reibungslose Preise bilden… das hat dann die Einschätzung selbstverstärkt, man könne endlich verstehen, wie Wirtschaft „wirklich“ funktioniert – und zwar immer schon und überall, also: ahistorisch. Und das ist alles auch deswegen tragisch, weil ökonomische Wissenschaft ja zuerst politische Ökonomie war, das heißt eine historische Wissenschaft. Einfach weil analysiert wurde, wie man von einer Wirtschaftsorganisation in die nächste kam und welche Probleme, Effekte und Akteure damit einhergingen. Die verbreitete Grundannahme von heute, dass es unorganisierte und politikfreie Wirtschaft überhaupt geben kann, schien absurd. Wir sind also geschlagen mit der Herrschaft eines bestimmten Typs ökonomischen Wissens, das den jeweiligen Stand der Forschung als Fortschritt bei der Einsicht in ahistorische Gesetzmäßigkeiten verstehen will. Und das erleichtert es ungemein, die Vergangenheit zu verklären und nicht mehr kritisch aufzuarbeiten.

In der Vorstellung, dass der gegenwärtige Zustand von vornherein immer der beste Zustand ist, steckt auch eine Wirtschaftsutopie: „Endlich haben wir den langersehnten Zustand erreicht, in dem es nur noch aufwärts gehen kann“. In den 1990er Jahren verhalf das Narrativ vom „Ende der Geschichte“ diesen Optimismus zu legitimieren. Man zog einen Schlussstrich unter die Vergangenheit und wer das Ideal der Ahistorizität hinterfragte, konnte schnell unter Ideologieverdacht geraten. Nicht nur in der Politik, sondern auch in den Universitäten und der Öffentlichkeit. Es war eine ubiquitäre Entwicklung, die bis heute nachwirkt…
Ja, die ganze Perspektive wird auch über das Erlernen bestimmter Erzählungen in unserer heutigen Sozialisation mitgetragen. Erzählungen über Geld und Haushaltsführung zum Beispiel. Aber sie wird auch über eine bestimmte Vorstellung von Ökonomie getragen, die in den Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften vorherrschend ist. Außerdem wird sie auch über bestimmte Vorstellungen im Recht getragen. Man sollte sich einmal angucken, welche Erzählungen bestimmte Gerichtsurteile und Urteilsbegründungen darüber enthalten, wie ein Staat sich zum Geld verhält. Isabel Feichtner hat ein schönes Paper dazu geschrieben. Vorausgesetzt wird etwa, dass der Staat nur funktionieren kann, wenn er Steuergelder einnimmt, deswegen muss es ihm auch immer möglich sein, Steuern einzunehmen. Gleichzeitig wird stabiles Geld in der Rechtsprechung als eine Voraussetzung persönlicher Freiheit gesehen. Auch in diesem Bereich verfestigen sich also bestimmte Perspektiven. Man denke nur einmal an das Steuerstaatsprinzip, das vom Bundesverfassungsgericht wiederholt festgestellt wurde – trotz der Tatsache, dass Staatsschulden die Grundlage der Geldversorgung bilden. Das führt alles dazu, dass sich diese Perspektive auf die Zahlungsfähigkeit der öffentlichen Hand aus verschiedenen Quellen speist und erhalten kann: Wissensproduktion der Ökonomik, Rechtssystem, populäre Geschichten, Sozialisation, die Art und Weise, wie unsere Institutionen funktionieren usw.. All dies stabilisiert die Konfiguration unseres Diskurses und das Setting an Erwartungen, aus welcher dann das Kriterium stammt, wer als vernünftiger oder rückwärtsgewandter Diskursteilnehmer gilt. Und das ist heute eine vertrackte Situation. Wobei man die eigene Rolle und die eigenen Möglichkeiten deswegen nicht unter- oder überschätzen sollte. Man kann nur darauf bauen, dass man darüber sprechen kann und Koalitionen mit Leuten findet, die die Probleme einsehen und fordern, dass das Geldsystem verändert werden muss. Zum Beispiel weil unser heutiges Geldsystem dafür sorgt, dass enorm viel Geld für den Handel mit Vermögenswerten ausgegeben wird — eigentlich unendlich viel Geld — aber auf der anderen Seite jeder Taler und Pfennig dreimal umgedreht wird, wenn es um die ökologische Transformation oder die Bearbeitung von sozialen Krisen geht. Und daran muss man arbeiten. Man muss an all den verschiedenen Feldern ansetzen. In den Rechtswissenschaften haben wir Leute wie Katharina Pistor, die sehr genau wissen, wie das Geldsystem funktioniert, und deshalb auch fordern, dass es eine Reform der juristischen Ausbildung geben muss, damit die Menschen lernen, nicht immer nur rechtspositivistisch auszulegen, was immer schon so ausgelegt wurde. Die Leute sollen stattdessen dafür sensibilisiert werden, dass eine bestimmte Auslegung von Recht auch negative Konsequenzen haben kann. Es muss darüber hinaus auch die Kritik an einer bestimmten Mainstream-Ökonomie fortgesetzt werden, damit die Ökonom:innen-Ausbildung anders funktioniert. Hier leistet die Bewegung für eine plurale Ökonomik seit Jahren viel. Und es muss auch öffentlich ein anderer Umgang mit Staatsschulden gefunden werden. Scheinargumente wie, „wir dürfen unseren Kindern keine Schuldenberge hinterlassen, deshalb können wir leider unsere Schulgebäude nicht sanieren“, müssen herausgefordert und kritisch diskutiert werden. Das gelingt natürlich nicht immer, aber es ist der einzige Weg, wenn man etwas verändern will.
Der diskursive und argumentative Weg in den genannten Bereichen ist unvermeidbar. Doch stecken wir heute auch in der kniffligen Situation, dass wir zugleich auf die Politik setzen müssen. In Hinblick auf den Klimawandel geraten wir nämlich immer mehr unter Zeitdruck. Zwar müssen wir dafür sorgen, dass mehr Differenzierung, Versachlichung und Reflexion im Diskurs stattfindet, gleichzeitig müssen wir aber auch in den Klimaschutz investieren und wirksamere Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Bis die breite Mehrheit verstanden hat, dass die Herkunft des Geldes gar nicht das Problem ist, sondern vielmehr, wie wir mit unserem Geldsystem umgehen, kann es noch eine Weile dauern. Was also tun?
Es gibt letztlich zwei Strategien: die demokratische und die technokratische. Die demokratische Strategie ist, dass man erst einmal verändert, wie die Mehrheit über Geld nachdenkt, und dann darauf hofft, dass sie zu der Einsicht gelangt, dass das Geldsystem ein Teil der Lösung sein kann, und nicht ein Teil des Problems sein muss. Will man aber nicht darauf hoffen, dann bleibt die technokratische Strategie. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass man einen Fachdiskurs über eine Neuausrichtung der Geldpolitik führt und auf einen dementsprechenden Umbau der Institutionen setzt. Beide Optionen schließen einander aber nicht aus, wenngleich einige Leute, die die technokratische Lösung bevorzugen, vielleicht das Gegenargument vorbringen, dass die demokratische Lösung zu lange dauert und der Zustand sich dadurch immer weiter verschlechtert. Stattdessen würden sie vielleicht dafür plädieren, dass man Expert:innen überzeugt und parallel auf öffentliche Erzählungen setzt, die bewusst falsch sind, die aber helfen Windkraftwerke zu bauen oder den Deich zu erhöhen. Beispielsweise, indem man als Politiker:in einerseits die Schuldenbremse verteidigt und einen ausgeglichenen Staatshaushalt predigt, um Wähler:innen abzuholen, andererseits aber mit einer Entwicklungsbank mit unbegrenzter Rückendeckung durch die Zentralbank die ökologische Transformation mit Geld versorgt. Beide Politikoptionen haben Vor- und Nachteile. Der Technokratie kann man ein moralisches Demokratiedefizit vorwerfen, zugleich hat sie aber das Zeitargument auf ihrer Seite. Aus wissenschaftlicher Perspektive kann man aber nicht vorentscheiden, welcher Weg der Bessere ist. Wir werden beide Strategien brauchen und beide müssen auch ein Bewusstsein dafür haben, dass das Geldsystem ein Beitrag zur Lösung sein könnte, insofern man es politisiert.

Zum Abschluss würde ich gerne noch eine Idee einwerfen, zu der ich letztes Jahr einen Beitrag geschrieben habe. Es geht um die Einführung digitaler Zentralbankwährungen und ihr transformatives Potential. Ich plädiere dafür, dass man digitales Zentralbankgeld flächendeckend einsetzen und Zentralbanken auch an der Kreditvergabe beteiligen sollte. Bewahren nämlich immer mehr Menschen aus der Realwirtschat ihre Finanzmittel in Zentralbanken auf, dann sind sie auch immer weniger von kommerziellen Banken abhängig. Bei einer Finanzkrise bräuchten sie sich keine Sorgen mehr darüber machen, ob ihre Bank vielleicht ausfällt oder gar bankrott geht. Die Finanzierung der Realwirtschaft könnte so auf eine neue Grundlage gestellt werden, ohne den Finanzsektor zu regulieren. Was halten Sie von dieser Idee?
Was mich an digitalen Zentralbankwährungen fasziniert ist erstmal die Diskrepanz zwischen ihrem theoretischen Potential und der Art und Weise, wie sie jetzt gerade vorbereitet werden. Da gibt es ja enorme Unterschiede. Einerseits wird den Bürgerinnen und Bürger das Angebot gemacht, Konten bei Zentralbanken zu führen, andererseits wird dieses Angebot sofort wieder eingeschränkt, indem die Höhe der Einlagen gedeckelt wird. Es geht bei dem Zentralbankgeld also erstmal nur darum einen Ersatz für Bargeld bereitzustellen. Die Möglichkeit beispielsweise, dass Zentralbanken sich auch an der Kreditvergabe beteiligen könnten, wurde von vornherein ausgeschlossen. Obwohl ich diese Verengung kritisch sehe, begrüße ich das Angebot Geld in Zentralbanken aufzubewahren. Einfach weil dieses Angebot auch nochmal verdeutlicht, dass man heute mit einer privaten Bank zusammenarbeiten muss, um die eigene Miete zahlen zu können und zahlungsfähig zu sein. Künftig könnte man aber auch zahlungsfähig sein, ohne einen Vertrag mit einer privatwirtschaftlichen Bank abschließen zu müssen. Wo ich Ihnen aber sofort zustimmen würde, ist, dass das eigentliche Potential digitaler Zentralbankwährungen noch viel größer ist. Digitales Zentralbankgeld könnte eine echte Alternative zum Bankensektor schaffen, wenn man alle seine Geschäfte über Zentralbankkonten führen könnte. Leider hat man das Potential dieser Zentralbankwährungen aber sofort auf ein harmloses Instrument eingedampft. Derzeit beschäftige ich mich damit, nachzuvollziehen, warum das so gelaufen ist. Warum konnte die Debatte um das Potential dieser Zentralbankwährungen sich gar nicht entfalten? Auch in politischer Hinsicht hätte eine interessante Debatte daraus entstehen können. Es gibt nämlich Leute, die einem Staat immer unterstellen, dass er nach Macht greift, wo er nach Macht greifen kann. Das hat er aber beim Thema digitaler Zentralbankwährungen gar nicht getan. Die Politik hätte Digitalwährungen doch auch viel aggressiver als Gegengewicht zum privaten Finanzsystem oder als Erweiterung fiskalischer Spielräume anpreisen können – indem ein Staat etwa sagt: ich bezahle meine Beamtinnen oder meine Infrastrukturprojekte künftig über digitale Zentralbankkonten. Wenn zum Beispiel eine Brückenbaufirma einen Vertrag mit dem Staat abschließt, dann könnte der Staat die Firma mit Zentralbankgeld bezahlen, weil er dort auch viel bessere Konditionen bekommt und so weiter. Doch all dies wurde gar nicht öffentlich diskutiert, nicht mal ernsthaft als Option in den Raum gestellt. Eben weil die Zentralbanken gleich gesagt haben, dass es bei den Zentralbankwährungen nur um einen Ersatz für Bargeld geht. Dadurch wurde der Korridor des Diskurses von vornherein sehr schmal und das führt uns wieder zu der Frage zurück, wie sich eine bestimmte Ordnung eigentlich stabilisiert? Eben auch dadurch, dass Akteure wie Zentralbanken die Debatten um Alternativen sofort an sich reißen und entscheiden, welche Form ein neues Zahlungsmittel annehmen soll. Doch warum ist das Angelegenheit der Zentralbanken und nicht die öffentlicher Debatte und des Parlaments? Angesichts des enormen Potentials von Zentralbankwährungen würde ich schon sagen, dass das weit über die Befugnisse einer Behörde hinaus geht. Die Zentralbanken haben zwar Umfragen gemacht, wo einige Leute dann angegeben haben, dass ihnen Sicherheit und Anonymität oder sowas wichtig ist. In diesen Umfragen wurde aber nicht abgefragt, ob die Bürgerinnen und Bürger auch ein Gegengewicht zum Bankensektor haben möchten. Und das verdeutlicht nochmal wie eine Ordnung sich stabilisiert: Eben, indem der Korridor an Möglichkeiten, der eigentlich sehr breit ist, sofort eingeengt wird. Dadurch stabilisieren digitale Zentralbankwährungen – so, wie sie jetzt geplant werden – den Status Quo.
Es wurde auch von privaten Banken sehr vehement die Position verfochten, dass Zentralbankwährungen eine Wettbewerbs- und Konkurrenzsituation schaffen würden, die private Banken nicht haben wollen.
Ja, die haben sofort ein Stabilitätsargument gebracht und gemeint, dass die Zentralbanken die Stabilität der Geldordnung gefährden würde und dass sie diese Ordnung eigentlich stützen müssen. Doch eigentlich darf diese Debatte nicht zwischen den Banken und Zentralbanken stattfinden, sondern muss in der breiten Öffentlichkeit geführt werden. Eine Behörde sollte eben nicht allein darüber entscheiden, wie eine neue Währung eingeführt werden soll. Dafür ist Geld viel zu wichtig.
Vielen Dank für das Gespräch!
Bilder von Lukas Biermann
 Lesezeit 31 Minuten
Lesezeit 31 Minuten